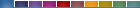Immobilien- und Mietrecht.
Volltexturteile nach Sachgebieten
3339 Entscheidungen insgesamt
Online seit 2018
IMRRS 2018, 0458 Wohnraummiete
Wohnraummiete
LG Berlin, Urteil vom 01.03.2018 - 67 S 342/17
Zahlt der Mieter trotz Vorliegens eines Mangels vorbehaltlos die vollständige Miete, kann er seine Überzahlungen gemäß § 812 BGB im Umfang der gemäß § 536 BGB eingetretenen Minderung kondizieren, ohne dass dem Vermieter im Rahmen des § 814 Alt. 1 BGB für eine mieterseitige Kenntnis seiner Nichtschuld Darlegungs- oder Beweiserleichterungen zu Gute kommen. Eine tatsächliche Vermutung, dem Mieter sei "sein Recht zur Herabsetzung der Miete" regelmäßig in einer die Anwendbarkeit des § 814 Alt. 1 BGB begründenden Weise bekannt, ist nicht gerechtfertigt (Abgrenzung zu BGH, Urteil vom 16.07.2003 - VIII ZR 274/02, IBR 2003, 702).*)
 Volltext
Volltext
IMRRS 2018, 0455
 Gewerberaummiete
Gewerberaummiete
LG Schwerin, Urteil vom 22.03.2018 - 21 HK O 42/17
Verpflichtet sich der Mieter, eine Bankfiliale in den Mieträumen zu betreiben, so muss er auch eine Filiale, d. h. mit Personal, dort führen. Allein das Aufstellen von Bankautomaten in den Mieträumen genügt hierfür nicht.
 Volltext
Volltext
IMRRS 2018, 0453
 Wohnraummiete
Wohnraummiete
LG Frankfurt/Main, Urteil vom 27.03.2018 - 2-11 S 183/17
Die sog. "Mietpreisbremse" ist in Hessen unwirksam, da die Hessische Mietbegrenzungsverordnung nicht ordnungsgemäß begründet worden ist.
 Volltext
Volltext
IMRRS 2018, 0447
 Gewerberaummiete
Gewerberaummiete
OLG Frankfurt, Urteil vom 08.03.2018 - 2 U 25/17
Steht dem gewerblichen Mieter infolge Festlaufzeit des Mietvertrags allein ein außerordentliches Kündigungsrecht zur Verfügung, erklärt er aber ohne einen zur Kündigung berechtigenden wichtigen Grund, den Mietvertrag möglichst bald beenden zu wollen, kann seine Erklärung in einen Antrag auf einvernehmliche Vertragsbeendigung umgedeutet werden. Macht der Vermieter die Entlassung des Mieters aus dem Mietverhältnis davon abhängig, dass dieser den vereinbarten Miet-AGB entsprechend 50% der bis zum Ablauf der nächsterreichbaren ordentlichen Kündigungsfrist zu zahlenden "Gesamtvergütung" leistet und verhält sich der Mieter daraufhin zunächst wie ein beendigungswilliger Mieter, bleibt aber die Zahlung schuldig, kann, selbst wenn die formularvertragliche Regelung Wirksamkeitsbedenken ausgesetzt ist, von einer individualvertraglichen Bestätigung i.S.v. §§ 141 Abs. 2, 305 Abs. 1 Satz 3 BGB ausgegangen werden.*)
 Volltext
Volltext
IMRRS 2018, 0438
 Wohnraummiete
Wohnraummiete
AG Köln, Urteil vom 27.01.2017 - 220 C 332/16
1. Kosten der Gartenpflege sind prinzipiell umlagefähige Betriebskosten.
2. Das Fällen von Bäumen gehört nicht zur Gartenpflege, so dass dies auch keine umlagefähigen Betriebskosten sind.
3. Dies gilt zumindest dann, wenn der Abholzung keine Neupflanzung folgt.
 Volltext
Volltext
IMRRS 2018, 0422
 Wohnraummiete
Wohnraummiete
BGH, Urteil vom 28.02.2018 - VIII ZR 157/17
Schäden an der Sachsubstanz der Mietsache, die durch eine Verletzung von Obhutspflichten des Mieters entstanden sind, hat dieser nach § 280 Abs. 1, § 241 Abs. 2 BGB als Schadensersatz neben der Leistung nach Wahl des Vermieters durch Wiederherstellung (§ 249 Abs. 1 BGB) oder durch Geldzahlung (§ 249 Abs. 2 BGB) zu ersetzen. Einer vorherigen Fristsetzung des Vermieters bedarf es dazu nicht. Das gilt unabhängig von der Frage, ob es um einen Schadensausgleich während eines laufenden Mietverhältnisses oder nach dessen Beendigung geht.*)
 Volltext
Volltext
IMRRS 2018, 0398
 Wohnraummiete
Wohnraummiete
LG Lübeck, Urteil vom 15.02.2018 - 14 S 14/17
1. Der Mieter darf ohne besondere Absprache einen Mindeststandard erwarten, der den heutigen Maßstäben gerecht wird.
2. Der Mieter kann deshalb auch in Altbauwohnungen verlangen, dass die Wohnung schimmelfrei ist, selbst wenn die Wohnung entsprechend dem damaligen Baustandard errichtet wurde und zum Errichtungszeitpunkt die Ursachen der Entstehung von Schimmelbefall noch nicht hinreichend bekannt waren.
3. Für die Annahme eines Mangels genügt es außerdem, wenn die konkrete Gefahr besteht, dass der Mietgebrauch durch die infrage stehende Beschaffenheit jederzeit erheblich beeinträchtigt werden könnte.
4. Es ist nicht erforderlich, dass der Mieter von dieser Gefahr Kenntnis hat oder dass der Fehler überhaupt erkennbar ist.
5. Ein Mieter ist - ohne besondere vertragliche Vereinbarungen - grundsätzlich nur verpflichtet, täglich zweimal für fünf bis zehn Minuten Stoß zu lüften und die Innenraumtemperatur im Schlafzimmer auf mindestens 16° C und in allen übrigen Räumen auf mindestens 20° C zu halten: hierbei ist bereits die Feuchtigkeitsproduktion beim Kochen und Duschen berücksichtigt.
6. Das Gebäude ist daher mangelhaft, wenn nur durch übermäßiges und unwirtschaftlich heißes Heizen und Lüften Feuchtigkeitsschäden vermieden werden.
7. Ist es notwendig, zur nachhaltigen Vermeidung von Schimmelpilzbefall die Wohnung dreimal täglich für ca. neun Minuten zu lüften, handelt es sich bereits um das Erfordernis eines übermäßigen Lüftens.
8. Die Grenze der Zumutbarkeit ist ferner überschritten, wenn die ständige Beheizung des Schlafzimmers mit 20° C notwendig ist.
9. Des Weiteren ist die Zumutbarkeitsgrenze überschritten bei dem notwendigen Einbau einer Dämmung oder Aufstellen zusätzlicher Heizquellen.
10. Der Mieter muss die Möglichkeit haben, seine Möbel grundsätzlich an jeden beliebigen Platz in der Wohnung nahe der Wand aufzustellen. Denn es gehört zur Gebrauchstauglichkeit eines Wohnraums, dass er in üblicher Art mit Möbeln eingerichtet werden kann.
11. Auch eine besondere "Klimapflege" unter Zuhilfenahme eines Hygrometers, mit der das Ablagern von Kondensfeuchtigkeit mit der Folge des Pilzbefalls vermieden werden könnte, kann nicht als "übliches" Wohnverhalten von Mietern gefordert werden.
12. Der Vermieter einer schadensanfälligen Wohnung ist verpflichtet, dem Mieter genaue Hinweise über die Art des Heizens und Lüftens zu geben.
13. Eine Klausel, dass der Mieter für eine ausreichende Lüftung und Heizung der Mieträume zu sorgen hat, ist die Beschreibung einer regelhaften Mieterpflicht und ihr kann deshalb der Erklärungsinhalt einer spezifischen Einschränkung einer Hauptleistungspflicht des Vermieters nicht beigemessen werden.
14. Neben der Minderung kann der Mieter auch ein - zeitlich und Höhe mäßig begrenztes - Zurückbehaltungsrecht an der Miete geltend machen, um den Vermieter zur Mangelbeseitigung anzuhalten.
15. Hat der Mieter kein Interesse mehr an der Erfüllung, kann das Zurückbehaltungsrecht ganz entfallen.
16. In dem Moment, in dem der Mieter den Vorschuss für eine Selbstbeseitigung des Mangels verlangt, gibt er zu erkennen, dass er den Erfüllungsanspruch selbst gar nicht mehr ernstlich verfolgt.
17. Der zur Ersatzvornahme Berechtigte hat einen Anspruch auf Leistung eines Vorschusses in Höhe der voraussichtlich zur Mängelbeseitigung erforderlichen Kosten.
 Volltext
Volltext
IMRRS 2018, 0390
 Wohnraummiete
Wohnraummiete
AG Bremen, Urteil vom 09.03.2018 - 7 C 284/17
Anforderungen an eine wirksame Modernisierungsankündigung bei einer energetischen Modernisierung als Voraussetzung für die Duldungspflicht des Mieters.*)
 Volltext
Volltext
IMRRS 2018, 0288
 Wohnraummiete
Wohnraummiete
AG Wedding, Urteil vom 05.07.2017 - 8a C 74/17
1. Dem Berliner Mietspiegel 2015 kommt als einfacher Mietspiegel im Sinne des § 558c Abs. 1 BGB Indizwirkung zu.
2. Entscheidend für das Vorliegen des Merkmals Fahrradabstellmöglichkeit ist allein, ob eine Fahrradabstellmöglichkeit außerhalb der eigenen angemieteten (Keller-)Räume besteht.
 Volltext
Volltext
IMRRS 2018, 0246
 Wohnraummiete
Wohnraummiete
AG Reinbek, Urteil vom 06.06.2017 - 14 C 509/16
1. zur Abgrenzung der beiden Kündigungstatbestände des § 543 Abs. 2 Nr. 3 a und b BGB kommt es maßgeblich darauf an, ob der Rückstand (ausschließlich) aus zwei aufeinander folgenden oder aus mehr als zwei aufeinander folgenden Zahlungsterminen herrührt. In dem erstgenannten Fall kann der Vermieter kündigen, wenn der Rückstand eine Monatsmiete übersteigt (Nr. 3 a Alt. 2 BGB). Im letztgenannten Fall setzt das Kündigungsrecht voraus, dass ein Rückstand von zwei Monatsmieten besteht (Nr. 3 b BGB).
2. Auch der Vermieter das Recht, seine Leistung (hier: Schimmelbeseitigung) im Falle des nicht unerheblichen Vertragsbruchs der Mieter (hier: keine Mietzahlung) zurückzuhalten.
 Volltext
Volltext
IMRRS 2018, 0341
 Gewerberaummiete
Gewerberaummiete
KG, Urteil vom 08.01.2018 - 8 U 21/17
1. Ein Vermieterpfandrecht kann gegenüber dem Mieter auch für ältere Mietforderungen geltend gemacht werden, dies ist gemäß § 562d BGB nur gegenüber Drittgläubigern ausgeschlossen.
2. Das Vermieterpfandrecht erfasst auch § 812 ZPO unterfallende Gegenstände.
3. Zur Wahrung der Frist des § 562b Abs. 2 genügt jedes Verhalten des Vermieters, mit dem er den Willen, sein Pfandrecht aufrechtzuerhalten und geltend zu machen, in einem gerichtlichen Verfahren deutlich nach außen betätigt.
4. Das Vermieterpfandrecht fällt unter § 289 StGB und es stellt ein "Wegnehmen" im Sinne dieser Vorschrift dar, eine Sache dem tatsächlichen Herrschafts- und Gewaltverhältnis des Vermieters über sein Grundstück und seinem Selbsthilferecht (§ 561 BGB) zu entziehen.
5. "Wegnehmen" bedeutet deshalb bei § 289 StGB nichts anderes als dem Machtbereich des Berechtigten entziehen.
IMRRS 2018, 0364
 Wohnraummiete
Wohnraummiete
LSG Sachsen-Anhalt, Urteil vom 31.01.2018 - L 5 AS 201/17
1. Der Landkreis Harz (Fläche 2.104 km²) ist als Gebietskörperschaft kein einheitlicher "Vergleichsraum", denn seine kreisangehörigen Gemeinden weisen erhebliche strukturelle Unterschiede auf, die sich bei einer bewertenden Betrachtung von Topografie, Siedlungsdichte und Infrastruktur ergeben. Er besteht ausgehend von den Wohnorten aus 14 Vergleichsräumen, zumeist in Form der politischen Gemeinden. Diese verfügen über jeweils eigene Wohnungsmärkte (vgl Urteil des Senats vom 11.05.2017 - L 5 AS 547/16).*)
2. Die Bestimmung des Vergleichsraums ist nicht im Rahmen der Methodenfreiheit allein der Behörde vorbehalten und insbesondere nicht der gerichtlichen Überprüfung entzogen.*)
3. Die durchgeführte Mietwerterhebung für den gesamten Landkreis Harz genügt unter Berücksichtigung der Methodenfreiheit den Anforderungen des BSG an ein schlüssiges Konzept für die Ermittlung der angemessenen Kosten der Unterkunft (Bruttokaltmiete). Insbesondere erfolgte die Mietdatenerhebung in allen vom Senat festgestellten Vergleichsräumen. Umfang sowie Art und Weise der Datenerhebung sind im Rahmen der Methodenfreiheit nicht zu bemängeln. Es ist auch zulässig, dass im Rahmen der Datenauswertung durch die sog "Clusteranalyse" einzelne Vergleichsräume zu Wohnungsmarkttypen zusammen gefasst worden sind. Dabei handelt es sich um eine statistisch anerkannte Methode mit dem Zweck, die Datenbasis zu verbreitern. Die dafür gewählten Kriterien sind schlüssig.*)
4. Die Fortschreibung des Konzepts ist nach zwei Jahren ab Veröffentlichung der Richtlinie der Behörde vorzunehmen, wenn dies im zeitlichen Zusammenhang mit der Beendigung der Datenerhebung und -auswertung geschieht. Die Vorgehensweise, eine Überprüfung und Neufestsetzung der Unterkunftskosten anhand der Entwicklung der Wohnungsmieten und Wohnungsnebenkosten im Land Sachsen-Anhalt vorzunehmen, ist im Rahmen der Methodenfreiheit nicht zu beanstanden. Das Gleiche gilt für den Vergleich der Indexentwicklung vom Stichtag der Datenerhebung an bis zum Ablauf der Zweijahresfrist nach Inkrafttreten der Richtlinie.*)
5. Die Ermittlung der angemessenen Heizkosten anhand der Vorauszahlungsbeträge für Heiz- und Warmwasserkosten im Rahmen der Mietwerterhebung plus Sicherheitszuschlag genügt nicht den Anforderungen des BSG an ein schlüssiges Konzept. Insoweit ist auf die Tabellenwerte des Bundesweiten Heizspiegels abzustellen, der im Zeitpunkt der letzten behördlichen Entscheidung veröffentlicht war. Die dort enthaltenen Euro-Beträge sind mit der angemessenen Wohnfläche zu multiplizieren. Bei dezentraler Beheizung der Unterkunft ist ein Abzug entsprechend den Vorgaben des Bundesweiten Heizspiegels vorzunehmen. Zudem ist der Mehrbedarf für dezentrale Warmwassererzeugung beim Bedarf zu berücksichtigen.*)
6. Zu den Heizkosten gehören die Stromkosten für die dezentrale Heizungsanlage. Soweit keine Nachweise über den Stromverbrauch vorliegen, ist dieser mit 5% der angemessenen Heizkosten zu schätzen.*)
 Volltext
Volltext
IMRRS 2018, 0362
 Prozessuales
Prozessuales
KG, Beschluss vom 28.12.2017 - 12 W 48/17
1. Wird die Räumung "wegen der Beendigung des Mietverhältnisses" begehrt, ist für die Festsetzung des Streitwerts nicht entscheidend, aus welchem Grund der Mietvertrag beendet wurde.
2. Maßgeblich für die Streitwertfestsetzung ist der Jahresbetrag des zuletzt geschuldeten Mietzinses ohne Nebenkosten.
 Volltext
Volltext
IMRRS 2018, 0348
 Wohnraummiete
Wohnraummiete
LG Hamburg, Urteil vom 09.01.2018 - 334 S 31/16
Ergibt sich bereits aus der Betriebskostenabrechnung selbst die Fehlerhaftigkeit, so ist eine Belegeinsicht nicht erforderlich. Dies ist etwa der Fall, wenn der Vermieter fehlerhaft die Heizkosten und die Wassererwärmungskosten zusammengelegt hat.
 Volltext
Volltext
IMRRS 2018, 0347
 Insolvenz und Zwangsvollstreckung
Insolvenz und Zwangsvollstreckung
OLG Saarbrücken, Urteil vom 10.01.2018 - 5 U 5/17
1. Teilen eine GmbH als bisherige Mieterin und eine neu gegründete GmbH unter gemeinsamem Briefkopf dem Vermieter mit, dass sein bisheriger Vertragspartner künftig unter dem Namen der neu gegründeten GmbH "firmiere", so kann dies als Vereinbarung einer Vertragsübernahme zwischen bisherigem und neuem Mieter auszulegen sein. Die notwendige Genehmigung der Vertragsübernahme durch den Vermieter, die kein echtes Erklärungsbewusstsein erfordert, kann dann darin liegen, dass dieser der gleichzeitig geäußerten Bitte, bei Erteilung von Rechnungen künftig die neue "Firmierung" zu beachten, entspricht.*)
2. Beantwortet der Insolvenzverwalter die Anfrage des Vermieters, ob die Mietsache nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens weiter genutzt werde, dahin, dass er bis zum Eingreifen einer angedachten Auffanglösung "als Insolvenzverwalter für die Verträge verantwortlich" bleibe, so ist diese Erklärung aus Sicht eines objektiven Empfängers als Erfüllungswahl anzusehen.*)
3. Kommt der Insolvenzverwalter seiner Pflicht zur Herausgabe der Mietsache nicht nach, kann der Vermieter entsprechend § 546a BGB für die Dauer der Vorenthaltung als Entschädigung die vereinbarte Miete - als Masseverbindlichkeit - verlangen.
IMRRS 2018, 0346
 Gewerberaummiete
Gewerberaummiete
OLG Dresden, Urteil vom 28.02.2018 - 5 U 1439/17
1. Eine empfangsbedürftige Willenserklärung ist gemäß §§ 133, 157 BGB so auszulegen, wie sie der Erklärungsempfänger nach Treu und Glauben unter Berücksichtigung der Verkehrssitte verstehen musste. Der Erklärungsempfänger ist verpflichtet, unter Berücksichtigung aller ihm erkennbaren Umstände zu prüfen, was der Erklärende gemeint hat. Entscheidend ist dabei der durch normative Auslegung zu ermittelnde objektive Erklärungswert des Verhaltens des Erklärenden (vgl. BGH, Urteil vom 05.10.2006 - III ZR 166/05, NJW 2006, 3777; Urteil vom 10.12.2014 - VIII ZR 25/14, NZM 2015, 207).*)
2. Für das Wirksamwerden einer empfangsbedürftigen Willenserklärung ist - außer dem Zugang beim Erklärungsgegner - erforderlich, aber auch ausreichend, dass sie mit Willen des Erklärenden in den Verkehr gelangt ist, von ihm also begeben wurde, und der Erklärende damit rechnen konnte und gerechnet hat, dass sie (sei es auch auf Umwegen) den richtigen Empfänger erreichen werde (vgl. BGH, Urteil vom 11.05.1978 - V ZR 177/77, NJW 1979, 2032; Urteil vom 25.02.1983 - V ZR 290/81, WM 1983, 712; Urteil vom 18.12.2002 - IV ZR 39/02, NJW-RR 2003, 384; OLG München, Beschluss vom 06.09.2005 - 32 Wx 60/05, NZM 2005, 750; Förschler, JuS 1980, 796, 797). Die empfangsbedürftige Willenserklärung braucht danach zwar nicht unmittelbar an den Erklärungsgegner abgesandt zu werden; sie kann ihm auch über Dritte zugeleitet werden, doch darf dies nicht mehr oder weniger zufällig, sondern muss zielgerichtet geschehen, denn es gibt im bürgerlichen Recht keinen dem § 187 ZPO a.F. (§ 189 ZPO n.F.) für die Heilung von Zustellmängeln entsprechenden Grundsatz (vgl. BGH, a.a.O.).*)
IMRRS 2018, 0336
 Versicherungen
Versicherungen
OLG Rostock, Urteil vom 01.02.2018 - 3 U 94/15
Wird der Brand eines Ferienhauses fahrlässig durch dessen Mieter oder eine zur Nutzung mitberechtigte Person verursacht, erstreckt sich der von der Rechtsprechung angenommene konkludente Regressverzicht des Versicherers des Vermieters auch hierauf.*)
 Volltext
Volltext
IMRRS 2018, 0339
 Wohnraummiete
Wohnraummiete
LG Darmstadt, Beschluss vom 28.04.2017 - 6 S 65/17
Die Benennung von vier Wohnungsanzeigen eines einzigen Online-Marktplatzes für Immobilien ist bei weitem nicht ausreichend, um darzulegen, dass man sich um eine Wohnung bemüht hat.
 Volltext
Volltext
IMRRS 2018, 0330
 Mietrecht
Mietrecht
LG Berlin, Beschluss vom 06.11.2017 - 65 S 209/17
(ohne amtlichen Leitsatz)
 Volltext
Volltext
IMRRS 2018, 0314
 Gewerberaummiete
Gewerberaummiete
KG, Beschluss vom 23.10.2017 - 8 U 91/17
1. Für die Ausübung einer Verlängerungsoption genügt ein Telefax.
2. Wird eine dritte Person bevollmächtigt, für den Vermieter Mietverhältnisse zu kündigen und zu beenden, ist sie somit auch bevollmächtigt, Vertragsverlängerungen seitens des Mieters zu widersprechen.
3. Für die Frage, ob eine Zurückweisung i.S.d. § 174 Satz 1 BGB unverzüglich erfolgt ist, gelten die zu § 121 BGB aufgestellten Grundsätze entsprechend. Unverzüglich bedeutet ohne schuldhaftes Zögern.
4. Die Zurückweisung einer Kündigung ist nach einer Zeitspanne von mehr als einer Woche ohne das Vorliegen besonderer Umstände des Einzelfalls nicht mehr unverzüglich i.S.d. § 174 Satz 1 BGB.
5. Das Gleiche gilt bei der Erklärung eines Widerspruchs gegen eine Vertragsverlängerung.
6. Der Mieter hat grundsätzlich bauliche Änderungen an der Mietsache einschließlich von ihm errichteter Gebäude bei Beendigung des Mietverhältnisses zu beseitigen, sofern sich nicht aus den Umständen ergibt, dass der Vermieter hierauf verzichtet hat.
7. Auch der Mieter von Gewerberaum, der von seinem Mietvorgänger im Einverständnis mit dem Vermieter Einbauten übernimmt, hat im Rahmen seiner Rückgabepflicht diese bei Beendigung des Mietvertrags zu entfernen und insoweit den früheren Zustand wiederherzustellen, weil er sich mit Abschluss des Mietvertrags behandeln lassen muss wie ein Mieter, der die eingebrachten Sachen erst nach Abschluss des Mietvertrags einbaut und mit Beendigung des Mietverhältnisses zu entfernen hat.
8. Verbindet ein Mieter, Pächter oder in ähnlicher Weise schuldrechtlich Berechtigter Sachen mit dem Grund und Boden, so spricht regelmäßig eine Vermutung dafür, dass dies mangels besonderer Vereinbarungen nur in seinem Interesse für die Dauer des Vertragsverhältnisses und damit zu einem vorübergehenden Zweck i.S.v. § 95 BGB geschieht.
9. Zudem trifft den Mieter auch dann eine Rückbaupflicht, wenn der Vermieter Eigentümer der vom Mieter errichteten Baulichkeit geworden ist.
IMRRS 2018, 0315
 Wohnraummiete
Wohnraummiete
OLG München, Urteil vom 09.11.2017 - 14 U 464/17
(ohne amtlichen Leitsatz)
 Volltext
Volltext
IMRRS 2018, 0322
 Wohnraummiete
Wohnraummiete
LSG Nordrhein-Westfalen, Beschluss vom 05.02.2018 - L 19 AS 2382/17 B
1. Die Übernahme von Mietschulden erfolgt nicht, um den Antragsteller von zivilrechtlichen Forderungen freizustellen oder um Ansprüche des Vermieters zu sichern. Zweck der Leistung ist allein die (längerfristige) Sicherung der Unterkunft.
2. Dies ist bei Erlass eines Räumungstitels zu Gunsten des Vermieters als Voraussetzung einer Duldung der weiteren Nutzung der Wohnung nicht gewährleistet.
 Volltext
Volltext
IMRRS 2018, 0321
 Wohnraummiete
Wohnraummiete
AG Bergisch Gladbach, Urteil vom 15.02.2018 - 60 C 436/15
1. Das außerordentliche Kündigungsrecht wegen Schimmelpilzbefalls setzt zwar nicht voraus, dass bereits eine Gesundheitsgefährdung eingetreten ist. Es genügt vielmehr, wenn eine solche Gefahr zum Zeitpunkt des Kündigungsausspruches ernsthaft in Betracht gezogen werden muss, d. h. wenn eine Gefährdung der Gesundheit nach sachkundiger Beurteilung nicht ausgeschlossen werden kann.
2. Bei Schimmelbildung genügt jedoch nicht die Feststellung, dass Schimmel im Allgemeinen zu Gesundheitsgefährdungen führen kann. Vielmehr ist im Einzelfall anhand objektiver Kriterien zu ermitteln, welcher Art der Schimmel zuzuordnen ist und welche konkreten Gefahren bei der Nutzung der Mietsache bestehen.
3. Sind sämtliche Wohnräume von der Feuchtigkeits-/Schimmelbelastung betroffen, ist eine Minderung von 80% angemessen.
4. Die Anzeigepflicht des Schimmelbefalls entfällt, wenn der Vermieter auf andere Weise Kenntnis erlangt hat oder ohne Weiteres hätte erlangen können. Letzteres ist bei einem durchfeuchteten Sockelputz im Außenbereich der Fall.
5. Fehlt die Erläuterung des Verteilerschlüssels und ist dieser nicht aus sich heraus verständlich, so ist die Betriebskostenabrechnung formell nicht ordnungsgemäß.
6. Müssen aufgrund des Schimmelpilzbefalls Mobiliar, Spielzeug etc. neu angeschafft werden, so ist ein Abzug "neu für alt" beim Schadensersatzanspruch vorzunehmen.
7. Der Anspruch aus § 536a Abs. 1 BGB unterliegt der regulären Verjährungsfrist. § 548 Abs. 2 BGB ist nicht anwendbar.
 Volltext
Volltext
IMRRS 2018, 0275
 Gewerberaummiete
Gewerberaummiete
AG Berlin-Mitte, Urteil vom 05.01.2018 - 124 C 45/17
1. Ein konkludenter Mietaufhebungsvertrag setzt einen klar erkennbaren und unzweifelhaften Willen zur Vertragsbeendigung voraus. Die vorzeitige Schlüsselrückgabe und Abnahme reichen hierfür nicht aus.
2. Der Mieter trägt die Darlegungs- und Beweislast für die ersparten Aufwendungen des Vermieters i.S.d. § 537 Abs. 1 Satz 2 BGB.
3. Die voreilige Rückgabe ist eine Pflichtverletzung, so dass gem. § 242 BGB der Mietzahlungsanspruch aufrechterhalten bleibt.
4. Die Verweigerung der vollumfänglichen Belegeinsicht lässt den Eintritt der Fälligkeit der Nebenkostennachzahlung entfallen.
 Volltext
Volltext
IMRRS 2018, 0156
 Wohnraummiete
Wohnraummiete
LG Berlin, Urteil vom 02.06.2017 - 63 S 316/16
1. Dem Mieter steht zwar ein ausschließliches Nutzungsrecht - und zwar grundsätzlich auch unter Ausschluss des Eigentümers - zu. Dieses ausschließliche Nutzungsrecht ist aber insoweit eingeschränkt, als die Besichtigung von Mängeln, insbesondere solcher, die vom Mieter gerügt worden sind, gerade der Erhaltung der Mietsache und der Gewährung des Gebrauchs dient.
2. Sowohl die Auswahl der Maßnahmen und die Art deren Ausführung als auch die Auswahl der hierzu herangezogenen Personen unterliegt allein der Disposition des Vermieters und nicht der Mitbestimmung des Mieters.
3. Weigert sich der Mieter, einen Rechtsanwalt und eine Maklerin als Beauftragten des Vermieters ein Betreten des gemieteten Grundstücks zur Besichtigung von Mängeln zu ermöglichen, ist dem Vermieter eine Fortsetzung des Mietverhältnisses nicht mehr zuzumuten.
 Volltext
Volltext
IMRRS 2018, 0287
 Mietrecht
Mietrecht
OLG Frankfurt, Beschluss vom 09.02.2018 - 2 W 11/18
(ohne amtlichen Leitsatz)
 Volltext
Volltext
IMRRS 2018, 0305
 Gewerberaummiete
Gewerberaummiete
BGH, Urteil vom 24.01.2018 - XII ZR 120/16
1. Der die stillschweigende Verlängerung eines Mietverhältnisses nach Ablauf der Mietzeit hindernde Widerspruch kann konkludent, schon vor Beendigung des Mietverhältnisses und damit jedenfalls auch mit der Kündigung erklärt werden. Eine konkludente Widerspruchserklärung muss den Willen, die Fortsetzung des Vertrags abzulehnen, eindeutig zum Ausdruck bringen (im Anschluss an BGH Urteil vom 16.09.1987 - VIII ZR 156/86, NJW-RR 1988, 76, und Senatsurteil vom 12.07.2006 - XII ZR 178/03, NJW-RR 2006, 1385).*)
2. In einem Räumungsverlangen kann eine solche konkludente Widerspruchserklärung liegen (im Anschluss an Senatsurteil vom 12.07.2006 - XII ZR 178/03, NJW-RR 2006, 1385).*)
3. Nach einer außerordentlichen Vermieterkündigung eines befristeten Mietverhältnisses kann der Vermieter vom Mieter den Mietausfallschaden auch dann verlangen, wenn es gemäß § 545 BGB zu einer stillschweigenden unbefristeten Vertragsverlängerung kommt und der Mieter in der Folge seinerseits ordentlich kündigt.*)
4. Zur Pflicht des Vermieters, den Schaden gering zu halten.*)
5. Beim Mietausfall als Kündigungsfolgeschaden handelt es sich nicht um ein Entgelt im Sinne des § 1 Abs. 1 Nr. 1 UStG, so dass der Schadensersatz die Umsatzsteuer nicht umfasst (im Anschluss an Senatsurteil vom 23.04.2008 - XII ZR 136/05, IMR 2009, 45 = ZMR 2008, 867).*)
 Volltext
Volltext
IMRRS 2018, 0303
 Gewerberaummiete
Gewerberaummiete
OLG Dresden, Urteil vom 14.06.2017 - 5 U 1426/16
Jede nicht durch einen gerichtlichen Titel gedeckte eigenmächtige Inbesitznahme von Räumlichkeiten und deren eigenmächtiges Ausräumen durch den Vermieter ist jedenfalls so lange, wie der Mieter seinen an den Räumen bestehenden Besitz nicht erkennbar aufgegeben hat, eine verbotene Eigenmacht i.S.v. § 858 Abs. 1 BGB und zugleich eine unerlaubte Selbsthilfe i.S.v. § 229 BGB, für deren Folgen der Vermieter nach § 231 BGB haftet (Anschluss BGH, NJW 2010, 3435; OLG Nürnberg, ZMR 2014, 543).*)
 Volltext
Volltext
IMRRS 2018, 0281
 Gewerberaummiete
Gewerberaummiete
LG Düsseldorf, Urteil vom 19.07.2017 - 23 O 372/16
1. Die tatsächlichen Voraussetzungen einer wirksamen Stellvertretung muss derjenige beweisen, der daraus Rechtswirkungen für sich herleitet, dies gilt ebenfalls für die Vertretungsmacht.
2. Ein Beweisantritt, der nicht unmittelbar oder mittelbar dem Beweis vom Beweisführer vorgetragener Tatsachen dient, sondern der Ausforschung von Tatsachen oder der Erschließung von Erkenntnissen, die es erst ermöglichen sollen, ausgehend davon Tatsachen zu behaupten und anschließend unter Beweis zu stellen, ist unzulässig.
3. Für eine Berücksichtigung von Störungen der Geschäftsgrundlage besteht grundsätzlich insoweit kein Raum, als es um Erwartungen und Umstände geht, die nach den vertraglichen Vereinbarungen in den Risikobereich einer der Parteien fallen sollen.
4. Im Verhältnis zwischen Vermieter und Mieter trägt grundsätzlich der Mieter das Verwendungsrisiko der Mietsache. Dazu gehört bei der gewerblichen Miete vor allem auch das Risiko, Gewinne mit dem Mietobjekt erzielen zu können.
5. Allein der Umstand, dass auch dem Vermieter an einem wirtschaftlichen Erfolg des Einkaufszentrums gelegen ist, verlagert das Verwendungs- und Gewinnerzielungsrisiko für das einzelne gemietete Geschäft in dem Einkaufszentrum nicht vom Mieter auf den Vermieter.
 Volltext
Volltext
IMRRS 2018, 0298
 Wohnraummiete
Wohnraummiete
BGH, Urteil vom 31.01.2018 - VIII ZR 39/17
Hat das Jobcenter das dem Wohnungsmieter zustehende Arbeitslosengeld II als Bedarf für Unterkunft und Heizung versehentlich auch noch nach der Beendigung des Mietverhältnisses im Wege der Direktzahlung nach § 22 Abs. 7 Satz 1 SGB II an den bisherigen Vermieter gezahlt, kann es von diesem - unter dem Gesichtspunkt einer fehlenden (widerrufenen) Anweisung - unmittelbar die Herausgabe der ohne rechtlichen Grund erfolgten Zuvielzahlung im Wege der Nichtleistungskondiktion (§ 812 Abs. 1 Satz 1 Alt. 2 BGB) verlangen.*)
 Volltext
Volltext
IMRRS 2018, 0219
 Gewerberaummiete
Gewerberaummiete
LG Münster, Urteil vom 24.01.2018 - 24 O 36/15
1. § 313 Abs. 2 BGB erfasst die Fälle des gemeinschaftlichen Irrtums über einen für die Willensbildung wesentlichen Umstand und setzt zudem voraus, dass eine Störung in der Geschäftsgrundlage nicht in den Risikobereich einer der Parteien fällt.
2. Aus wirtschaftlichen Gründen ist es nicht zu beanstanden, wenn ein defekter Trafo nicht repariert, sondern durch einen gebrauchten Trafo ersetzt wird, wenn die Reparatur nicht günstiger wäre. Dies gilt insbesondere dann, wenn der Austausch innerhalb eines Tages erfolgt und eine Reparatur einen längeren Zeitraum in Anspruch nehmen würde und mithin eine längere Betriebsunterbrechung bedeuten würde.
3. Ist der Vermieter mit der Beseitigung des Mangels in Verzug, kann der Mieter zur Durchführung der erforderlichen Arbeiten im Rahmen einer Selbsthilfemaßnahme einen Vorschuss in Höhe der voraussichtlich erforderlichen Kosten verlangen.
4. Zudem muss der Mieter in diesem Fall die Arbeiten nicht mehr vom Vermieter vornehmen lassen.
 Volltext
Volltext
IMRRS 2017, 1671
 Wohnraummiete
Wohnraummiete
AG Berlin-Mitte, Urteil vom 14.06.2017 - 9 C 406/16
1. Bei einem Unterlassungspflichtverstoß (hier: Gefahr einer Kohlenmonoxydvergiftung aufgrund Betreibens eines Lüfters) ist dem Vermieter im Rahmen seiner Gläubiger-Obliegenheit zuzumuten, zunächst durch eigene Kontaktaufnahme zum Mieter dessen Fehlverhalten aufzuzeigen und ihn von dessen Wiederholung abzubringen. Eines Rechtsanwalts bedarf es hierfür nicht.
2. Eine zumindest durchschnittlich mit Mietwohnungs-Angelegenheiten sachlich und rechtlich bewanderte Hausverwaltung muss erst recht in der Lage sein, das in Rede stehende Fehlverhalten ohne vorherige externe rechtliche Beratung durch einen Rechtsanwalt selbständig und zutreffend zu beurteilen sowie eine entsprechende eigene Abmahnung gegenüber dem Mieter auszusprechen.
3. Aufgrund der eigenen Lebensgefahr ist auch nicht davon auszugehen, dass der Mieter aufgrund "nur" eines Schreibens der Hausverwaltung sein lebensgefährliches Handeln nicht eingestellt hätte.
 Volltext
Volltext
IMRRS 2018, 0267
 Wohnraummiete
Wohnraummiete
BGH, Beschluss vom 30.01.2018 - VIII ZB 74/16
1. Zahlt der Mieter dreimal die erhöhte Miete, hat er der Mieterhöhung konkludent zugestimmt.
2. Der Vermieter hat keinen Anspruch auf eine schriftliche Zustimmung.
 Volltext
Volltext
IMRRS 2018, 0248
 Öffentliches Recht
Öffentliches Recht
KG, Urteil vom 29.12.2017 - 21 U 82/17
1. Nach der Aufnahme eines Asylbewerbers in eine gewerbliche private Unterkunft hat der Betreiber jedenfalls dann einen direkten zivilrechtlichen Zahlungsanspruch gegen das Land Berlin für seine Leistungen, wenn er diese aufgrund der im vorliegenden Fall verwendeten Kostenübernahmeerklärung des Landes aus dem Jahr 2015 erbracht hat.*)
2. Die Kostenübernahmebereitschaft des Landes bezieht sich aber nicht auf einen einseitig vom Beherbergungsbetrieb festgesetzten Preis, sondern nur seinen "allgemein ausgewiesenen günstigsten Kostenansatz". Zumindest wenn ein Beherbergungsbetrieb überhaupt erst für die Aufnahme von Asylbewerbern eröffnet oder wieder eröffnet wird, liegt der Vergütung, die der Beherbergungsbetrieb hierfür ausweist, die anlassbezogene einseitige Leistungsbestimmung einer Vertragspartei zugrunde. Diese ist für das Land nur verbindlich, wenn sie nach billigem Ermessen getroffen worden ist, andernfalls muss die Leistungsbestimmung durch gerichtliches Urteil erfolgen (§ 315 Abs. 3 BGB).*)
3. Hat der Beherbergungsbetrieb für die Aufnahme von Asylbewerbern vom Land Abschlagszahlungen erhalten, dann war dies mit der zumindest konkludenten Abrede verbunden, dass eine Schlussabrechnung tatsächlich eine Vergütung in der entsprechenden Höhe ergibt. Eine etwaige Überzahlung ist auf vertraglicher Anspruchsgrundlage zurück zu gewähren. Wird eine umstrittene Überzahlung zurückgefordert, hat der Empfänger von Abschlagszahlungen darzulegen und zu beweisen, in welchem Umfang er tatsächlich Beherbergungsleistungen erbracht hat.*)
 Volltext
Volltext
IMRRS 2018, 0266
 Wohnraummiete
Wohnraummiete
BGH, Urteil vom 31.01.2018 - VIII ZR 105/17
1. Eine objektiv feststehende finanzielle Leistungsunfähigkeit eines nach dem Tod des Mieters in das Mietverhältnis Eintretenden kann einen wichtigen Grund zur Kündigung des Mietverhältnisses nach § 563 Abs. 4 BGB darstellen. Voraussetzung hierfür ist regelmäßig, dass dem Vermieter ein Zuwarten, bis die Voraussetzungen einer Kündigung wegen Zahlungsverzugs nach § 543 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 BGB erfüllt sind, nicht zuzumuten ist.*)
2. Eine auf eine nur drohende finanzielle Leistungsunfähigkeit oder eine "gefährdet erscheinende" Leistungsfähigkeit des Eintretenden gestützte Unzumutbarkeit der Fortsetzung des Mietverhältnisses stellt nur dann einen Kündigungsgrund nach § 563 Abs. 4 BGB dar, wenn sie auf konkreten Anhaltspunkten und objektiven Umständen beruht, die nicht bloß die Erwartung rechtfertigen, sondern vielmehr den zuverlässigen Schluss zulassen, dass fällige Mietzahlungen alsbald ausbleiben werden. Solche Anhaltspunkte fehlen dann, wenn Geldquellen vorhanden sind, die die Erbringung der Mietzahlungen sicherstellen, wie dies etwa bei staatlichen Hilfen, sonstigen Einkünften oder vorhandenem Vermögen der Fall ist.*)
3. Bereits der Wunsch, nach dem Auszug eines bisherigen Wohngenossen, nicht allein zu leben, kann ein nach Abschluss des Mietvertrags entstandenes berechtigtes Interesse an der Überlassung eines Teils des Wohnraums an einer Untervermietung begründen (im Anschluss an Senatsbeschluss [Rechtsentscheid] vom 03.10.1984 - VIII ARZ 2/84, BGHZ 92, 213, 219). Entsprechendes gilt bei einer aufgrund einer nachträglichen Entwicklung entstandenen Absicht, Mietaufwendungen teilweise durch eine Untervermietung zu decken (Fortführung der Senatsurteile vom 23.11.2005 - VIII ZR 4/05, NJW 2006, 1200 Rz. 8, und vom 11.06.2014 - VIII ZR 349/13, IMR 2014, 319 = NJW 2014, 2717 Rz. 14).*)
4. Für die Beurteilung der Frage, ob das berechtigte Interesse nach Abschluss des Mietvertrags entstanden ist, kommt es auch bei einem nach § 563 Abs. 1, 2 BGB erfolgten Eintritt eines Mieters auf den Zeitpunkt des Abschlusses des ursprünglichen Mietvertrags an.*)
IMRRS 2018, 0265
 Wohnraummiete
Wohnraummiete
BGH, Urteil vom 17.01.2018 - VIII ZR 241/16
Eine gewerbliche Weitervermietung, die eine geschäftsmäßige, auf Dauer gerichtete und mit der Absicht der Gewinnerzielung oder im eigenen wirtschaftlichen Interesse ausgeübte Vermietungstätigkeit voraussetzt, liegt auch dann vor, wenn der Zwischenvermieter die von ihm angemieteten Wohnungen an die Arbeitnehmer seines Gewerbebetriebes weitervermieten will, um diese an sich zu binden und sich Wettbewerbsvorteile gegenüber anderen Unternehmen zu verschaffen, die ihren Arbeitnehmern keine Werkswohnungen anbieten können; eine Gewinnerzielungsabsicht aus der Vermietung selbst ist nicht erforderlich (Bestätigung und Fortführung von BGH, Urteil vom 20.01.2016 - VIII ZR 311/14, IMR 2016, 144= NJW 2016, 1086, Rz. 22).*)
 Volltext
Volltext
IMRRS 2018, 0257
 Wohnraummiete
Wohnraummiete
AG Frankfurt/Main, Urteil vom 08.02.2018 - 33 C 2877/17
Dass eine Küche an zwei Stellen ohne Tür frei zugänglich ist, macht sie nicht zu einer integrierten Küche im Sinne des Mietspiegels der Stadt Frankfurt am Main für das Jahr 2016.*)
 Volltext
Volltext
IMRRS 2018, 0225
 Mietrecht
Mietrecht
LG Berlin, Urteil vom 17.01.2018 - 18 S 308/13
1. Im Rahmen eines in Berlin nach dem 31.12.2003 zu Stande gekommenen Wohnungsmietverhältnisses ist die Wohnfläche mangels anderweitiger Vereinbarung der Vertragsparteien nach der Wohnflächenverordnung zu ermitteln, so dass Wintergärten, Balkone und Terrassen regelmäßig nicht mit der Hälfte, sondern nur mit einem Viertel ihrer Grundfläche zu berücksichtigen sind. Eine örtliche Verkehrssitte, der Wohnflächenermittlung ein anderes Regelwerk als die Wohnflächenverordnung zu Grunde zu legen, gibt es in Berlin nicht. Die dennoch weit verbreitete Praxis, die Grundflächen von Balkonen und Terrassen grundsätzlich zur Hälfte zu berücksichtigten, stellt sich als fehlerhafte Anwendung des zur Wohnflächenermittlung herangezogenen Regelwerks dar und kann der Vertragsauslegung deshalb nicht als örtliche Übung zu Grunde gelegt werden (entgegen LG Berlin, Urteil vom 19.07.2011 - 65 S 130/10, GE 2011, 1086 f.; Anschluss BGH, Urteil vom 23.05.2007 - VIII ZR 231/06, IMR 2007, 241 = GE 2007, 1047 ff.).*)
2. Im Rahmen eines Mieterhöhungsverlangens nach §§ 558 ff. BGB ist die ortsübliche Vergleichsmiete auch dann an Hand der tatsächlichen Wohnfläche zu ermitteln, wenn diese um bis zu 10% von der vertraglich zu Grunde gelegten Wohnfläche abweicht. Die Zehnprozent-Grenze ist aber für die Ermittlung der Kappungsgrenze von Bedeutung. Bleibt die tatsächliche Wohnfläche mehr als 10% hinter der vertraglich vorgesehenen Wohnfläche zurück, liegt regelmäßig ein zur Mietminderung führender Mangel der Wohnung vor, der nicht behebbar ist, sondern die Beschaffenheit der Wohnung bestimmt. Die Kappungsgrenze ist dann an Hand der geminderten Ausgangsmiete zu ermitteln (Anschluss BGH, Urteil vom 18.11.2015 - VIII ZR 266/14, IMR 2016, 60 f. = GE 2016, 49 ff.; Abgrenzung BGH, Urteil vom 22.02.2006 - VIII ZR 219/04, NJW-RR 2006, 801 f.; LG Hamburg, Urteil vom 01.07.2004 - 307 S 52/04, WE 2005, 20 f.).*)
 Volltext
Volltext
IMRRS 2018, 0226
 Wohnraummiete
Wohnraummiete
LG Berlin, Urteil vom 14.02.2018 - 64 S 74/17
1. Das Gericht ist befugt, die ortsübliche Miete gemäß §§ 287 ZPO, 558c BGB im Wege der Schätzung anhand des Berliner Mietspiegels 2017 zu ermitteln. Es ist nicht gezwungen, ein Sachverständigengutachten einzuholen.
2. Gilt die Mieterhöhung ab dem 01.09.2016, ist der Mietspiegel 2017 anzuwenden, dessen Erhebungsstichtag ebenfalls der 01.09.2016 ist. Allerdings ist ein Abschlag von den Werten dieses Mietspiegels vorzunehmen, da das Mieterhöhungsverlangen dem Mieter vor dem 01.09.2016 zugegangen ist.
3. Eine Primärdatenerhebung für einen einfachen Mietspiegel muss nicht die hohen Anforderungen der Repräsentativität erfüllen, sondern kann etwa auch in der Weise erfolgen, dass die Mitglieder eines oder mehrerer Interessenverbände befragt werden.
4. Hat ein Mieter Anspruch auf Überlassung von Herd und Spüle, so führt seine Entscheidung, Herd und Spüle nicht abrufen zu wollen, nicht zur Abwertung der Wohnung; darauf, ob der Vermieter dadurch tatsächlich Aufwände spart, kommt es nicht an.
 Volltext
Volltext
IMRRS 2018, 0223
 Öffentliches Recht
Öffentliches Recht
VG Berlin, Beschluss vom 23.01.2018 - 6 L 756.17
Auch die Vermietung von Wohnraum an Unternehmen zur vorübergehenden Unterkunft von Mitarbeitern verstößt gegen das Berliner Zweckentfremdungsverbot-Gesetz.
 Volltext
Volltext
IMRRS 2018, 0221
 Wohnraummiete
Wohnraummiete
LG Berlin, Beschluss vom 08.01.2018 - 66 S 240/17
1. Erfolgt die Gutschrift einer Mietzahlung zum Ende eines Monats, so hängt die Erfüllungswirkung (für den auslaufenden oder aber den bevorstehenden Monat) zunächst davon ab, ob die Auslegung das Vorliegen einer Tilgungsbestimmung ergibt. Ist ein tatsächlicher Wille nicht zu ermitteln, oder ist er von Irrtum oder Unkenntnis beeinflusst, so kann sich eine Tilgungsbestimmung - und damit ein Ausschluss des § 366 Abs. 2 BGB auch aus dem mutmaßlichen Willen des Leistenden ergeben.*)
2. Da § 366 Abs. 1 BGB die Befugnis zur Tilgungsbestimmung dem Leistenden als Vergünstigung eröffnet, kommt dem objektiv erkennbaren Interesse des Leistenden im Rahmen der Auslegung entscheidende Bedeutung zu. Bei Zahlungen der Sozialbehörden (Jobcenter) ist das von ihnen mit der Leistung (ggf. mutmaßlich) verfolgte Interesse entscheidend.*)
3. Bei behördlichen Leistungen für Unterkunft und Heizung muss der Vermieter den in § 22 SGB II geregelten Auftrag der Sozialbehörden als (ggf. auch stillschweigend verfolgtes) Leistungsinteresse gegen sich gelten lassen. Dieses Interesse ist darauf gerichtet, die Unterkunft des Anspruchsberechtigten zu sichern, um dadurch gegenwärtigen und künftigen Wohnbedarf zu decken. Kann diesem Leistungsinteresse durch eine von mehreren denkbaren Verbuchungen des eingegangenen Betrages entsprochen werden, so ist eine andere Behandlung der Zahlung wegen Nichtbeachtung der (stillschweigende) Tilgungsbestimmung unzulässig.*)
 Volltext
Volltext
IMRRS 2018, 0218
 Wohnraummiete
Wohnraummiete
LG Berlin, Urteil vom 25.01.2018 - 67 S 272/17
1. Das Berufungsgericht darf die Sache unter Aufhebung des Urteils zurückverweisen, soweit das Verfahren des ersten Rechtszugs an einem wesentlichen Mangel leidet und aufgrund dieses Mangels eine umfangreiche oder aufwändige Beweisaufnahme erforderlich ist.
2. Während der Mieter seiner Bestreitenslast schon mit einem Bestreiten mit Nichtwissen i.S.d. § 138 Abs. 4 ZPO genügt, reicht für eine auf streitigen Eigenbedarf gestützte Räumungsverurteilung allein der Vollbeweis des behaupteten Eigenbedarfs, nicht hingegen die bloße Plausibilität des Kündigungsvorbringens aus.
3. Zwar kann ein unredliches Prozessverhalten des Mieters im Räumungsprozess den gesonderten Ausspruch einer verhaltensbedingten Kündigung rechtfertigen. Um der Pflichtverletzung des Mieters das für den Ausspruch einer Kündigung hinreichende Gewicht zu verleihen, muss sein wahrheitswidriger Prozessvortrag jedoch zumindest ein (Gegen-)Vorbringen des Vermieters betreffen, das für die Schlüssigkeit der Räumungsklage unerlässlich ist und für deren Erfolg nicht hinweggedacht werden kann.
4. Für die Bejahung des § 574 Abs. 1 BGB müssen die dem Mieter entstehenden Nachteile nicht mit absoluter Sicherheit feststehen, sondern insbesondere bei gesundheitlichen Nachteilen des Mieters kann bereits die ernsthafte Gefahr ihres Eintritts ausreichen, um eine Fortsetzung des Mietverhältnisses zu gebieten.
5. Eine die Anwendung des § 574 Abs. 1 BGB eröffnende Räumungsunfähigkeit liegt bereits dann vor, wenn sich der Gesundheitszustand oder die allgemeine Lebenssituation des Mieters durch den Umzug erheblich verschlechtern würde.
6. Eine zur Fortsetzung des Mietverhältnisses berechtigende Härte gem. § 574 Abs. 2 BGB liegt auch dann vor, wenn angemessener Ersatzwohnraum zu zumutbaren Bedingungen nicht beschafft werden kann. Dabei ist die Angemessenheit des Ersatzwohnraums nicht nur durch das Alter und die Krankheit des Mieters, sondern auch von der dadurch bedingten notwendigen Nähe zu bestimmten Angehörigen beeinflusst.
 Volltext
Volltext
IMRRS 2018, 0212
 Gewerberaummiete
Gewerberaummiete
OLG Karlsruhe, Beschluss vom 22.08.2017 - 9 U 141/15
1. Führen Wassereintritte nach Niederschlägen mehrfach zu Schäden in einem Schuhgeschäft, wird die Tauglichkeit der Mietsache zum vertragsgemäßen Gebrauch für die Folgezeit schon durch die konkrete Gefahr weiterer Wassereintritte erheblich gemindert.*)
2. Macht der Mieter nach einem Wassereintritt Schadensersatzansprüche geltend, muss der Vermieter gem. § 536a Abs. 1 Alt. 2 BGB sein fehlendes Verschulden beweisen, wenn die Ursache des Wassereintritts in seinem Herrschaftsbereich liegt (hier: Eintritt von Niederschlagswasser durch das Dach).*)
 Volltext
Volltext
IMRRS 2018, 0211
 Gewerberaummiete
Gewerberaummiete
OLG Hamm, Urteil vom 05.10.2017 - 18 U 23/15
1. Ein Aufwendungsersatzanspruch des Mieters gem. §§ 539 Abs. 1, 677, 683 Satz 1 BGB setzt u.a. Fremdgeschäftsführungswillen des Mieters voraus, der nur bei einem objektiv fremden Geschäft vermutet wird. Nimmt der Mieter die Maßnahmen zumal nach eigenen Bedürfnissen und Vorstellungen im Interesse des eigenen Geschäfts vor, ist eher von einem neutralen Geschäft auszugehen.*)
2. Auch ein Anspruch aus §§ 684 Satz 1, 818 Abs. 2 BGB setzt Fremdgeschäftsführungswillen voraus (OLG Düsseldorf, Beschluss vom 19.10.2009 - 24 U 58/09, IMRRS 2010, 1326).*)
3. Ein Anspruch auf Ausgleich einer Wertsteigerung am Mietgrundstück gem. §§ 951 Abs. 1, 812 Abs. 1 Satz 1 Alt. 1, 812 Abs. 2 BGB scheidet aus, soweit es wegen § 95 Abs. 1 Satz 1 BGB nicht zu einem Eigentumswerb des Vermieters gekommen ist.*)
4. Ein Anspruch des Mieters auf Wertausgleich ergibt sich auch nicht, wenn er die von ihm getroffenen baulichen Maßnahmen auf dem Grundstück belässt, denn § 539 Abs. 2 BGB regelt die wechselseitigen Ansprüche abschließend in der Weise, dass der eine Vertragspartner sein Eigentum an der Einrichtung nur durch rechtzeitige Wegnahme erhalten bzw. wiedererlangen kann und der andere die Wegnahme nur zu dulden hat (BGH, 08.07.1981 - VIII ZR 326/80).*)
 Volltext
Volltext
IMRRS 2018, 0209
 Wohnraummiete
Wohnraummiete
LG Berlin, Beschluss vom 25.01.2018 - 67 T 9/18
Kündigt der Vermieter Modernisierungsmaßnahmen gegenüber dem Mieter an und lässt der Mieter eine gesonderte - fristgebundene - Aufforderung des Vermieters, sich über seine künftige Duldungsbereitschaft zu erklären, unbeantwortet, gibt der Mieter, sofern er sich nicht bereits vorgerichtlich mit der Duldung der angekündigten Maßnahmen selbst in Verzug befindet, allenfalls dann Veranlassung zur Klageerhebung i.S.d. § 93 ZPO, wenn ihn der Vermieter vor Klageerhebung hinsichtlich der erbetenen Erklärung über seine künftige Duldungsbereitschaft in Verzug gesetzt hat. Das erfordert - vorbehaltich der Verwirklichung eines des Ausnahmetatbestände des § 286 Abs. 2 BGB – gemäß § 286 Abs. 1 BGB den Ausspruch einer gesonderten Mahnung im Nachgang zur erfolglosen ursprünglichen Aufforderung durch den Vermieter.*)
 Volltext
Volltext
IMRRS 2018, 0165
 Wohnraummiete
Wohnraummiete
LG München I, Urteil vom 18.01.2018 - 31 S 11267/17
1. Der Vermieter einer Eigentumswohnung hat über die Betriebskostenvorauszahlungen des Mieters grundsätzlich innerhalb der Jahresfrist des § 556 Abs. 3 Satz 2 BGB abzurechnen, auch wenn der WEG-Beschluss nach § 28 Abs. 5 WEG zu diesem Zeitpunkt noch nicht vorliegt.
2. Eine Entlastung hinsichtlich einer nicht fristgerecht vorgenommenen Abrechnung kommt aber dann in Betracht, wenn die Fristversäumnis für den Vermieter unverschuldet ist.
3. Dies ist dann der Fall, wenn aufgrund eines Rechtsstreits innerhalb der WEG keine Einzelabrechnungen über die Heizkosten vorliegen und der Vermieter dies dem Mieter mitteilt.
4. Im Allgemeinen muss der Vermieter innerhalb von 6 Monaten über die Kaution abrechnen; im Einzelfall kann die Abrechnungsfrist aber auch länger sein. Denn die Mietkaution sichert alle - auch die noch nicht fälligen - Ansprüche des Vermieters, die sich aus dem Mietverhältnis und seiner Abwicklung ergeben. Dazu gehören auch Ansprüche aus einer noch zu erstellenden Betriebskostenabrechnung.
5. Der Vermieter darf die Kaution über den regulären Abrechnungszeitraum hinaus zurückbehalten, wenn ein Nachzahlungsanspruch zu seinen Gunsten für noch nicht fällige Betriebskosten zu erwarten ist.
 Volltext
Volltext
IMRRS 2018, 0157
 Wohnraummiete
Wohnraummiete
LG Berlin, Urteil vom 24.10.2017 - 67 S 178/17
Auch nach der insoweit großzügigen Rechtsprechung des BGH bedarf es bei wiederkehrenden Beeinträchtigungen durch Lärm zumindest einer Beschreibung, aus der sich ergibt, um welche Art von Beeinträchtigungen es geht und zu welchen Tageszeiten, über welche Zeitdauer und in welcher Frequenz diese ungefähr auftreten (vgl. BGH, IMR 2012, 178).
 Volltext
Volltext
IMRRS 2018, 0158
 Gewerberaummiete
Gewerberaummiete
OLG Frankfurt, Urteil vom 11.09.2017 - 2 U 102/16
1. Die fristlose Kündigung eines Gewerberaummietverhältnisses wegen unterbliebener Sicherheitsleistung nach § 133 Abs. 1 Satz 2, § 22 UmwG aufgrund der Ausgliederung der Mieterin ist ausgeschlossen, sofern über die Leistung einer solchen Sicherheit noch verhandelt wird.
2. Eine fristlose Kündigung wegen unbefugter Untervermietung ist ausgeschlossen, wenn der Vermieter die Untervermietung über einen längeren Zeitraum hinweg stillschweigend geduldet hat.
3. Ein (Unter-)Mieter ist verpflichtet, auf die rechtlich geschützten Interessen des (Unter-)Vermieters auch über das Mietobjekt selbst hinaus Rücksicht zu nehmen, insbesondere soweit Verpflichtungen des Untervermieters gegenüber dessen Hauptvermieter betroffen sind.
 Volltext
Volltext
IMRRS 2018, 0166
 Wohnraummiete
Wohnraummiete
LG Berlin, Urteil vom 02.06.2017 - 63 S 304/16
1. Eine Betriebskostenabrechnung ist formell ordnungsgemäß, wenn sie den allgemeinen Anforderungen des § 259 BGB entspricht, also eine geordnete Zusammenstellung der Einnahmen und Ausgaben enthält.
2. Soweit keine besonderen Abreden getroffen sind, sind daher in die Abrechnung bei Gebäuden mit mehreren Wohneinheiten regelmäßig folgende Mindestangaben aufzunehmen: die Zusammenstellung der Gesamtkosten, die Angabe und - soweit erforderlich - die Erläuterung der zugrunde gelegten Verteilerschlüssel, die Berechnung des Anteils des Mieters und der Abzug der geleisteten Vorauszahlungen.
3. Die Berechnung des Verbrauchs einer Nutzergruppe durch Abzug des durch den Wärmezähler erfassten Verbrauchs der anderen Nutzergruppe von dem Gesamtverbrauch stellt keine Vorerfassung im Sinne von § 5 Abs. 1 Satz 1 HeizkostenV dar. Vielmehr ist dazu eine Messung durch ein geeignetes Gerät, namentlich einen Wärmezähler, erforderlich. Erfassen bedeutet nämlich messen, nicht berechnen.
4. Erfolgt für einen erheblichen Teil der Nutzer überhaupt keine Erfassung durch Messgeräte, bleibt danach nur eine insgesamt flächenanteilige Umlage der Kosten für die Warmwasserversorgung.
 Volltext
Volltext
IMRRS 2018, 0159
 Mietrecht
Mietrecht
AG Köln, Urteil vom 19.07.2017 - 201 C 62/17
(ohne amtlichen Leitsatz)
 Volltext
Volltext