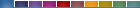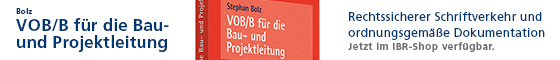Immobilien- und Mietrecht.
IBR 12/2025 - Vorwort

Liebe Leserin, lieber Leser,
im Bauvertragsrecht geht es bereits in dem Zeitschriftschaubeitrag zum Aufsatz von Jahn ( S. 625) um die Möglichkeit, einen Bauvertrag wegen Mängeln in der Ausführungsphase aus wichtigem Grund (§ 648a BGB) zu kündigen. Der Bundesgerichtshof hat in diesem Zusammenhang am 19.01.2023 bekanntermaßen entschieden, dass die Regelung des § 4 Abs. 7 Satz 3 VOB/B ebenso wie die hierauf rückbezogene Bestimmung in § 8 Abs. 3 Abs. 1 Satz 1 VOB/B bei Verwendung durch den Auftraggeber der AGB-Kontrolle nicht standhält und unwirksam ist, wenn die VOB/B nicht als Ganzes vereinbart wurde (
S. 625) um die Möglichkeit, einen Bauvertrag wegen Mängeln in der Ausführungsphase aus wichtigem Grund (§ 648a BGB) zu kündigen. Der Bundesgerichtshof hat in diesem Zusammenhang am 19.01.2023 bekanntermaßen entschieden, dass die Regelung des § 4 Abs. 7 Satz 3 VOB/B ebenso wie die hierauf rückbezogene Bestimmung in § 8 Abs. 3 Abs. 1 Satz 1 VOB/B bei Verwendung durch den Auftraggeber der AGB-Kontrolle nicht standhält und unwirksam ist, wenn die VOB/B nicht als Ganzes vereinbart wurde ( IBR 2023, 179). Aufgrunddessen bleibt dem Auftraggeber eines Werk- oder Bauvertrags nur der Rückgriff auf die Vorschrift des § 648a BGB, die auch im VOB/B-Vertrag anwendbar ist. Danach können beide Vertragsparteien den Vertrag aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist kündigen. Ein wichtiger Grund liegt vor, wenn dem kündigenden Teil unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls und unter Abwägung der beiderseitigen Interessen die Fortsetzung des Vertragsverhältnisses bis zur Fertigstellung des Werkes nicht zugemutet werden kann. Gemäß § 648a Abs. 3 BGB gilt § 314 Abs. 2 und 3 BGB entsprechend, so dass die Kündigung grundsätzlich erst nach erfolglosem Ablauf einer zur Abhilfe bestimmten Frist oder nach erfolgloser Abmahnung zulässig ist. „Normale“ Baumängel berechtigen den Auftraggeber nicht zur Kündigung aus wichtigem Grund (OLG Brandenburg,
IBR 2023, 179). Aufgrunddessen bleibt dem Auftraggeber eines Werk- oder Bauvertrags nur der Rückgriff auf die Vorschrift des § 648a BGB, die auch im VOB/B-Vertrag anwendbar ist. Danach können beide Vertragsparteien den Vertrag aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist kündigen. Ein wichtiger Grund liegt vor, wenn dem kündigenden Teil unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls und unter Abwägung der beiderseitigen Interessen die Fortsetzung des Vertragsverhältnisses bis zur Fertigstellung des Werkes nicht zugemutet werden kann. Gemäß § 648a Abs. 3 BGB gilt § 314 Abs. 2 und 3 BGB entsprechend, so dass die Kündigung grundsätzlich erst nach erfolglosem Ablauf einer zur Abhilfe bestimmten Frist oder nach erfolgloser Abmahnung zulässig ist. „Normale“ Baumängel berechtigen den Auftraggeber nicht zur Kündigung aus wichtigem Grund (OLG Brandenburg,  IBR 2011, 134). Die Kündigung wegen Mängeln vor der Abnahme ist deshalb nur in Ausnahmefällen zulässig.
IBR 2011, 134). Die Kündigung wegen Mängeln vor der Abnahme ist deshalb nur in Ausnahmefällen zulässig.
Die Kündigung eines Bauvertrags bedarf nach § 650h BGB der Schriftform. Schriftform heißt „Papier“, wenn das Gesetz die Schriftform vorschreibt. Die Kündigungserklärung muss also vom Aussteller eigenhändig durch Namensunterschrift oder mittels notariell beglaubigten Handzeichens unterzeichnet werden. Mit einer Kündigung per E-Mail mit angehängter PDF-Datei wird das Schriftformerfordernis nicht gewahrt (OLG München,  IBR 2022, 507). Wurde der Bauvertrag jedoch vor dem Inkrafttreten des „schlechten“ Bauvertragsrechts 2018 geschlossen oder handelt es sich „nur“ um einen VOB/B-Werkvertrag mit Bauwerksbezug und nicht um einen Bauvertrag i.S.v. 650a BGB, genügt für die Wahrung der gewillkürten Schriftformerfordernisse der VOB/B nach Ansicht des OLG Stuttgart die telekommunikative Übermittlung, z.B. per E-Mail (
IBR 2022, 507). Wurde der Bauvertrag jedoch vor dem Inkrafttreten des „schlechten“ Bauvertragsrechts 2018 geschlossen oder handelt es sich „nur“ um einen VOB/B-Werkvertrag mit Bauwerksbezug und nicht um einen Bauvertrag i.S.v. 650a BGB, genügt für die Wahrung der gewillkürten Schriftformerfordernisse der VOB/B nach Ansicht des OLG Stuttgart die telekommunikative Übermittlung, z.B. per E-Mail ( S. 633). Das entspricht der Rechtslage, auch wenn das OLG Frankfurt das einmal anders entschieden hat (
S. 633). Das entspricht der Rechtslage, auch wenn das OLG Frankfurt das einmal anders entschieden hat ( IBR 2012, 386). Der betreffende Senat des OLG Frankfurt hat das dementsprechend drei Jahre später (konkludent) richtig gestellt (
IBR 2012, 386). Der betreffende Senat des OLG Frankfurt hat das dementsprechend drei Jahre später (konkludent) richtig gestellt ( IBR 2016, 223).
IBR 2016, 223).
Hinzuweisen ist schließlich auf eine weitere interessante Entscheidung des OLG Stuttgart, wonach der Auftraggeber im Wege des Schadensersatzes fiktive Mängelbeseitigungskosten verlangen kann, wenn keine Überkompensation droht ( S. 637). Die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zum Ausschluss fiktiver Mängelbeseitigungskosten (
S. 637). Die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zum Ausschluss fiktiver Mängelbeseitigungskosten ( IBR 2018, 196) gilt übrigens auch nicht für Mangelfolgeschäden an Bauteilen außerhalb des Gewerkes des Unternehmers (OLG Düsseldorf,
IBR 2018, 196) gilt übrigens auch nicht für Mangelfolgeschäden an Bauteilen außerhalb des Gewerkes des Unternehmers (OLG Düsseldorf,  IBR 2023, 288; OLG Köln,
IBR 2023, 288; OLG Köln,  IBR 2023, 15). Das ist allerdings umstritten (siehe OLG Oldenburg,
IBR 2023, 15). Das ist allerdings umstritten (siehe OLG Oldenburg,  IBR 2021, 179) und höchstrichterlich nicht geklärt.
IBR 2021, 179) und höchstrichterlich nicht geklärt.
Im Recht der Architekten und Ingenieure erhitzt die Frage, ob und wenn ja in welchem Umfang der Planer für eine „Baukostenüberschreitung“ einstehen muss, regelmäßig die Gemüter. Eine typische Fallgestaltung stellt die Überschreitung einer vertraglich vereinbarten Baukostenobergrenze dar. Die vereinbarten Baukosten sind dann vereinbarte Beschaffenheit; übersteigen die tatsächlichen Baukosten die vereinbarten Baukosten, weicht das Architekten- und Ingenieurwerk von der vereinbarten Beschaffenheit ab und ist deshalb mangelhaft (statt aller: BGH,  IBR 2019, 500). Das OLG München hat insoweit klargestellt, dass der Auftraggeber die Vereinbarung einer Baukostenobergrenze in einer bestimmten Höhe darlegen und beweisen muss. Gelingt ihm das nicht, scheidet eine Mangelhaftung des Planers wegen Überschreitung der vereinbarten Baukosten von vorneherein aus (
IBR 2019, 500). Das OLG München hat insoweit klargestellt, dass der Auftraggeber die Vereinbarung einer Baukostenobergrenze in einer bestimmten Höhe darlegen und beweisen muss. Gelingt ihm das nicht, scheidet eine Mangelhaftung des Planers wegen Überschreitung der vereinbarten Baukosten von vorneherein aus ( S. 655). Eine Schadensersatzhaftung des Planers kann sich aber – unabhängig von einer etwaig vereinbarten Baukostenobergrenze – auch daraus ergeben, dass die von ihm übernommenen Leistungen der Kostenermittlung oder Kostenkontrolle mangelhaft erbracht sind. Im konkreten Einzelfall ist jedoch zu klären, ob die Mehrkosten auch tatsächlich infolge der mangelhaften Kostenermittlung und/oder Kostenkontrolle entstanden sind, sich also als kausale Folge der mangelhaften Leistungen erweisen. Nach Auffassung des OLG Brandenburg hat der Auftraggeber darzulegen und zu beweisen, dass er bei einer richtigen Information über die Kostenentwicklung das Projekt nicht in der durchgeführten Form fortgeführt, sondern nicht oder anders gebaut hätte. Im letzteren Fall hat er ein konkretes Projekt zu beschreiben und zu dessen Kosten vorzutragen. Die sog. Vermutung beratungsgerechten Verhaltens ist nicht anwendbar (
S. 655). Eine Schadensersatzhaftung des Planers kann sich aber – unabhängig von einer etwaig vereinbarten Baukostenobergrenze – auch daraus ergeben, dass die von ihm übernommenen Leistungen der Kostenermittlung oder Kostenkontrolle mangelhaft erbracht sind. Im konkreten Einzelfall ist jedoch zu klären, ob die Mehrkosten auch tatsächlich infolge der mangelhaften Kostenermittlung und/oder Kostenkontrolle entstanden sind, sich also als kausale Folge der mangelhaften Leistungen erweisen. Nach Auffassung des OLG Brandenburg hat der Auftraggeber darzulegen und zu beweisen, dass er bei einer richtigen Information über die Kostenentwicklung das Projekt nicht in der durchgeführten Form fortgeführt, sondern nicht oder anders gebaut hätte. Im letzteren Fall hat er ein konkretes Projekt zu beschreiben und zu dessen Kosten vorzutragen. Die sog. Vermutung beratungsgerechten Verhaltens ist nicht anwendbar ( S. 656).
S. 656).
Im Vergaberecht weist die VK Südbayern darauf hin, dass die Kalkulationsangaben der Bieter in den Formblättern 221 bis 223 auch bei Bauvergaben vertrauliche Angebotsinhalte i.S.d. § 5 Abs. 1 Satz 2 VgV bleiben, obwohl nach § 14 EU Abs. 6 VOB/A 2019 Bieternamen und Endbeträge bekanntzugeben sind. Der öffentliche Auftraggeber darf solche vertraulichen Angebotsinhalte deshalb nicht an von ihm beauftragte Planungsbüros herausgeben, erst recht nicht, wenn ihm durch Rüge personelle oder gesellschaftsrechtliche Verflechtungen dieser Planer mit Bietern bekannt werden ( S. 663).
S. 663).
Auch alle anderen Beiträge empfehlen wir Ihrer Aufmerksamkeit.
Mit den besten Grüßen
Dr. Stephan Bolz
Rechtsanwalt
Geschäftsführender Herausgeber der IBR
Thomas Ryll
Rechtsanwalt
Schriftleiter der IBR