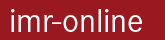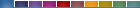Immobilien- und Mietrecht.
IMR 10/2024 - Vorwort

Liebe Leserinnen und liebe Leser,
das neue, durch das WEMoG komplett auf den Kopf gestellte Wohnungseigentumsgesetz ist seit fast vier Jahren in Kraft. Viele Probleme sind zwischenzeitlich auch in der höchstrichterlichen Rechtsprechung angekommen. Das ist zu begrüßen, da hierdurch Rechtssicherheit entsteht. Viele Fragen können zwischenzeitlich als „geklärt“ bezeichnet werden. Zu nennen sind etwa die Fragen der Notwendigkeit einer Beschlussfassung vor Durchführung einer baulichen Veränderung („keine bauliche Veränderung ohne Beschluss“). Das gilt sowohl für das „Ob“ als auch das „Wie“ einer baulichen Veränderung, wie im Urteil des LG Saarbrücken vom 05.03.2024 – 5 S 5/23 in einem einstweiligen Verfügungsverfahren sauber herausgearbeitet ( S. 426). Auch zur Frage, wann ein Beschluss über die Änderung des Kostenverteilerschlüssels gem. § 16 Abs. 2 Satz 2 WEG nicht mehr ordnungsmäßiger Verwaltung entspricht, finden sich vermehrt Entscheidungen, die zwar grundsätzlich auf den Einzelfall abstellen, aus denen sich jedoch eine gewisse Tendenz ergibt, mit der sich arbeiten lässt. Eine weitere Leitlinie kann dem Urteil des LG Frankfurt/Main vom 11.07.2024 – 2-13 S 19/24 entnommen werden (
S. 426). Auch zur Frage, wann ein Beschluss über die Änderung des Kostenverteilerschlüssels gem. § 16 Abs. 2 Satz 2 WEG nicht mehr ordnungsmäßiger Verwaltung entspricht, finden sich vermehrt Entscheidungen, die zwar grundsätzlich auf den Einzelfall abstellen, aus denen sich jedoch eine gewisse Tendenz ergibt, mit der sich arbeiten lässt. Eine weitere Leitlinie kann dem Urteil des LG Frankfurt/Main vom 11.07.2024 – 2-13 S 19/24 entnommen werden ( S. 428). Als Maßstab für die Ordnungsmäßigkeit kann auf den Gebrauch oder die Möglichkeit des Gebrauchs abgestellt werden. Die Frage, ob an der Rechtsfigur der „modernisierenden Instandsetzung“ entgegen der Begründung zur Gesetzesänderung durch das WEMoG festgehalten werden kann, auch wenn sich die Maßnahme nicht auf eine bloße Reparatur beschränkt, sondern hierdurch auch der ursprüngliche Zustand verändert wird, oder ob eine derartige Maßnahme in jedem Fall als bauliche Veränderung eingestuft werden muss, wartet noch dringend auf eine höchstrichterliche Klärung. Die Entscheidung des LG Berlin II (Urteil vom 29.02.2024 – 85 S 52/23 WEG) setzt sich mit dieser Frage mutig auseinander (
S. 428). Als Maßstab für die Ordnungsmäßigkeit kann auf den Gebrauch oder die Möglichkeit des Gebrauchs abgestellt werden. Die Frage, ob an der Rechtsfigur der „modernisierenden Instandsetzung“ entgegen der Begründung zur Gesetzesänderung durch das WEMoG festgehalten werden kann, auch wenn sich die Maßnahme nicht auf eine bloße Reparatur beschränkt, sondern hierdurch auch der ursprüngliche Zustand verändert wird, oder ob eine derartige Maßnahme in jedem Fall als bauliche Veränderung eingestuft werden muss, wartet noch dringend auf eine höchstrichterliche Klärung. Die Entscheidung des LG Berlin II (Urteil vom 29.02.2024 – 85 S 52/23 WEG) setzt sich mit dieser Frage mutig auseinander ( S. 424). Insbesondere im Hinblick darauf, dass eine der maßgeblichen Intentionen des Gesetzgebers zum WEMoG die Beseitigung des Modernisierungsstaus der in Wohnungseigentum aufgeteilten Gebäude war, spricht viel dafür, nicht jede Instandsetzungsmaßnahme, mit der eine Veränderung (Anpassung an zeitgemäße Standards) des baulichen Zustands einhergeht (Stichwort: Änderung des Soll-Zustands), als bauliche Veränderung einzuordnen. Damit würde sicherlich erneut ein Modernisierungsstau produziert. Das liegt vor allem an der (bereits im Gesetzgebungsverfahren heftig kritisierten) Kostenverteilungsregel des § 21 WEG. Muss eine Instandsetzung als bauliche Veränderung eingeordnet werden, nur weil nicht exakt der status quo ante hergestellt, sondern die Immobilie dem technischen Fortschritt angepasst wird, so wird es in Anbetracht des § 21 Abs. 3 WEG schwierig werden, eine positive Beschlussfassung herbeizuführen. Die Hürden des § 21 Abs. 2 Nr. 1 und 2 WEG, die eine Beteiligung aller Wohnungseigentümer an den Kosten bestimmen, sind zu hoch. Auch die Änderung des WEG, um die Umsetzung technischer Neuerungen zu erreichen, wie im Fall der Balkonkraftwerke, ist keine akzeptable Lösung. Es bleibt also zu hoffen, dass der BGH auch in dieser Konstellation eine klarstellende, mutige und zukunftsweisende Entscheidung treffen kann und trifft. Im Hinblick auf das Urteil des BGH vom 05.07.2024 (V ZR 241/23) bin ich guter Hoffnung (
S. 424). Insbesondere im Hinblick darauf, dass eine der maßgeblichen Intentionen des Gesetzgebers zum WEMoG die Beseitigung des Modernisierungsstaus der in Wohnungseigentum aufgeteilten Gebäude war, spricht viel dafür, nicht jede Instandsetzungsmaßnahme, mit der eine Veränderung (Anpassung an zeitgemäße Standards) des baulichen Zustands einhergeht (Stichwort: Änderung des Soll-Zustands), als bauliche Veränderung einzuordnen. Damit würde sicherlich erneut ein Modernisierungsstau produziert. Das liegt vor allem an der (bereits im Gesetzgebungsverfahren heftig kritisierten) Kostenverteilungsregel des § 21 WEG. Muss eine Instandsetzung als bauliche Veränderung eingeordnet werden, nur weil nicht exakt der status quo ante hergestellt, sondern die Immobilie dem technischen Fortschritt angepasst wird, so wird es in Anbetracht des § 21 Abs. 3 WEG schwierig werden, eine positive Beschlussfassung herbeizuführen. Die Hürden des § 21 Abs. 2 Nr. 1 und 2 WEG, die eine Beteiligung aller Wohnungseigentümer an den Kosten bestimmen, sind zu hoch. Auch die Änderung des WEG, um die Umsetzung technischer Neuerungen zu erreichen, wie im Fall der Balkonkraftwerke, ist keine akzeptable Lösung. Es bleibt also zu hoffen, dass der BGH auch in dieser Konstellation eine klarstellende, mutige und zukunftsweisende Entscheidung treffen kann und trifft. Im Hinblick auf das Urteil des BGH vom 05.07.2024 (V ZR 241/23) bin ich guter Hoffnung ( S. 422).
S. 422).
Grundsätzlich leisten die Wohnungseigentumsverwalter gute Arbeit. Grundsätzlich sind die Wohnungseigentümer mit der Arbeit der Verwalter einverstanden und zufrieden. Sie wollen sich in der Regel auch nicht in einer Vielzahl von Eigentümerversammlungen mit der immer gleichen Angelegenheit befassen, was zu einem großen Teil den Anforderungen der Rechtsprechung an Erhaltungsbeschlüsse geschuldet ist (Stichwort: „drei Angebote“, die angesichts der Marktverhältnisse kaum beizubringen sind). Bei der Anwaltschaft ergibt sich nur dadurch ein anderes Bild, weil dort regelmäßig die Problemfälle ankommen. Das zum 01.12.2020 in Kraft getretene WEG bietet hier eine Reihe von Gestaltungsmöglichkeiten, die genutzt werden sollten. Zu denken ist hier nicht nur an § 27 Abs. 2 WEG, sondern auch an § 23 Abs. 3 Satz 2 WEG.
Ich freue mich auf ein Wiedersehen und spannende Erkenntnisse in Mainz.
Beate Müller
RAin und FAin für Miet- und Wohnungseigentumsrecht